VorOrt
Nr. 42, Oktober
2007
(Auflage 15 000)
Zeitung
für das andere Vaihingen
Stuttgart
21 wirft dunkle Schatten Richtung
Vaihingen
ZOB in Vaihingen
fehl am Platz
Den „Zentralen” Omnibus Bahnhof (ZOB) in einen 12 km vom Zentrum entfernten Außenbezirk zu verlegen,
wird jedem einigermaßen Vernunftbegabten als Widerspruch in sich erscheinen. Bei Projekten wie
Stuttgart 21 aber spielt Vernunft eher eine untergeordnete Rolle. Es geht um Geld und Prestige.
Und so müssen sich die Bewohner des Stadtbezirks Vaihingen einmal mehr in der Abwehr Wohn- und
Lebensqualität mindernder Planungen üben.
Bereits 2003 war im Zuge der S21-Planung die Verlegung des ZOB an die Bahnlinie zwischen
Industrie- und Ruppmannstraße diskutiert und von Bezirksbeirat, Industrievereinigung und
Gemeinderat einmütig mit Hinweis auf die ohnehin überlasteten Straßen in diesem Bereich
abgelehnt worden. Erstaunt mussten jetzt die Vaihinger Bürger erfahren, dass die Stadtverwaltung
die Pläne dennoch weiter verfolgt hat und sie nun erneut auf den Tisch legt. Noch erstaunlicher
allerdings: nachdem sich die Verkehrsbelastung des Gebietes durch Aufsiedlung seit 2003 stark
erhöht hat und nach jüngsten Verkehrsprognosen bis 2010 noch einmal (ohne Busbahnhof) um gut
25% zunehmen wird, erklären die CDU-Gemeinderäte jetzt, sie hielten Vaihingen für einen guten
Standort, weil in der Innenstadt die Feinstaub-Belastung schon so hoch sei. Und die SPD weiß
noch nicht so recht, ob sie dafür oder dagegen ist. Erklären aber können sie allesamt nicht,
wie das heute bereits überlastete Straßennetz die jährlich 40.000 Bussfahrten mit 738.340
Fernreisegästen, die nach Auskunft von Reiseagenturen zu 80% mit Autos und Taxis zum Busbahnhof
kommen, aufnehmen soll. Zumal dann, wenn die Zufahrten zur Autobahn während der Bauzeit des
Fildertunnels für 5 Jahre noch zusätzlich durch Erd- und Betontransporte verstopft sein werden.
Vom geplanten „Zwischenangriff Sigmaringerstraße” nämlich, wo auf einer 1,73 Ha großen
Ackerfläche eine Großbaustelle eingerichtet wird, werden nach Angaben der DB ProjektBau
im 24-Stunden-Betrieb täglich 670 LkWs insgesamt 915.000 Kubikmeter Erd-aushub abtransportieren.
In einem Schreiben an den Oberbürgermeister und die Gemeinderäte haben Vaihinger Bürger nun die berechtigte
Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass sich die Busse angesichts einer chronisch verstopften
Nord-Süd-Straße mit Sicherheit ihren Weg zur Autobahn auch durch Vaihinger Wohngebiete suchen
werden. Vom Stadtplanungsamt erhielten sie bisher auf ihre Frage, warum man den ZOB nicht
sinnvoller im Zentrum ansiedle, nur die aufschlußreiche Antwort, die Gelände dort seien dafür zu wertvoll.
Die
Initiative Stolperstein
Stuttgart-Vaihingen verlegt
zwei neue Gedenksteine
Den
Opfern den Namen zurückgeben
Das ist die Absicht der
Initiative Stolpersteine,
die jetzt zwei weitere
Gedenksteine zur Erinnerung
an Opfer der Nazi-Diktatur
in Vaihingen verlegte.
Einen am Vaihinger Markt
12, wo August
Leitz, Inhaber
des von seiner Frau geführten
„Schokoladenhaus Mezger”
war. August Leitz wurde
Opfer des nationalsozialistischen
Kranken- und Behindertenmords.
An einer chronischen
Krankheit leidend wurde
er nach mehreren Klinikaufenthalten
1939 in die Landesheilanstalt
Zwiefalten gebracht und
von dort 1940 in die
Heilanstalt Weinsberg
verlegt. Aufgabe der
Anstalt Weinsberg war es,
zur Tötung vorgesehene Kranke
und Behinderte auf Abruf
für die Landesheilanstelt
Hadamar bereit zu halten.
Am 31. März 1941 wurde
August Leitz mit 52 weiteren
Patienten nach Hadamar
gebracht, wo man sie
gleich nach ihrer Ankunft
vergaste. von seiner Frau geführten
„Schokoladenhaus Mezger”
war. August Leitz wurde
Opfer des nationalsozialistischen
Kranken- und Behindertenmords.
An einer chronischen
Krankheit leidend wurde
er nach mehreren Klinikaufenthalten
1939 in die Landesheilanstalt
Zwiefalten gebracht und
von dort 1940 in die
Heilanstalt Weinsberg
verlegt. Aufgabe der
Anstalt Weinsberg war es,
zur Tötung vorgesehene Kranke
und Behinderte auf Abruf
für die Landesheilanstelt
Hadamar bereit zu halten.
Am 31. März 1941 wurde
August Leitz mit 52 weiteren
Patienten nach Hadamar
gebracht, wo man sie
gleich nach ihrer Ankunft
vergaste.
Mit einem „Stolperstein”
vor dem Haus Kelterberg
10/1 wird dem Vaihinger
Nazi-Gegner Gottlob
Häberle gedacht. Aus dem 1. Weltkrieg
war der Hilfsarbeiter als
Kriegsbeschädigter heimgekehrt
und musste von einer kleinen
Ren-te leben. Mit den Vaihinger
Repräsentanten der faschistischen
Diktatur lag der als links
geltende Häberle in ständigem
Streit. Auch als Vorstand
des Mietervereins Vaihingen
und Mitglied des Kriegsbeschädigtenbundes
lies er die Willkürmaßnahmen
der Nazi-Herren oft nicht
unwidersprochen. Weil
er den Vaihinger Bürgermeister
Dr. Walter Heller und
den NSDAP-Kreisleiter
Fischer als „größenwahnsinnig”
bezeichnet hatte, wurde
er 1934 erstmals für
10 Tage inhaftiert, nicht
ohne zuvor vom Ortsgruppenleiter
Junginger, einem fanatischen
Nazi, der Menschen öffentlich
ohrfeigte, wenn sie den
Hitlergruß nicht erwiderten,
auf der SA-Geschäftsstelle
in Vaihingen beschimpft
und mißhandelt worden
zu sein. Häberle beschwerte
sich bei der Gauamtsleitung
über die Schikanen durch
den Ortsgruppenleiter
mit der Folge, dass er
erneut als „notorischer
Hetzer” und ausdrücklich
zur Warnung anderer zu 10
Tagen Haft verurteilt wurde.
Als er immer noch nicht
klein beigab, wurde er im
Sommer 1936
in „Schutzhaft” genommen
und kam für 3 Monate ins
KZ Welzheim. Jemand hatte
ihn wegen „staatsabträglicher
Äußerungen über führende
Männer von Partei und Staat”
denunziert. Im Februar 1940
verschwand er erneut, diesmal
für 15 Monate im KZ Welzheim.
Lediglich knapp drei Monate
nach seiner Entlassung wurde
er im Juli 1941 wieder verhaftet
und diesmal ins KZ Sachsenhausen
verschleppt, wo er, als
das KZ im Februar vor den
heranrückenden sowjetischen
Truppen geräumt wurde, im
Alter von 52 Jahren von
SS-Schergen ermordet wurde.
Dass der Gottlob Häberle für seinen
verzweifelten Kampf gegen
die Nazi-Barbarei von den
Repräsentanten der Bundesrepublik
gleichsam ein weiteres Mal
verurteilt wurde, als das
Landesamt für Wiedergutmachung
den Antrag seiner Witwe
auf Entschädigung mit demselben
Nazi-Vokabular wie „Querulant”
und „abträgliche Äußerungen”
ablehnte, wirft auch auf
den Nachfolgestaat BRD kein
gutes Licht. Wie auch die
Ignoranz des heutigen Vaihinger
Bezirksbeirats, der sich
erst nach langem Hin- und
Her nur zu einer ärmlichen
Bezuschussung der Gedenksteine
durchringen konnte. Wer
etwas mehr Sensibilität
bezüglich des Gedenkens
der Nazi-Opfer in Vaihingen
und der Arbeit der Initiative
Stolperseine aufbringt,
kann diese mit Spenden unterstützen:
Initiative Stolpersteine Vaihingen,
Kontonummer 888050260, Bankleitzahl
60070024
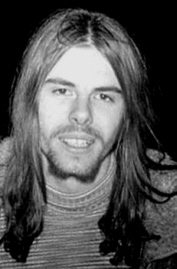 Gerhard
Wick Gerhard
Wick
Schäuble
will‘s wissen
Und zwar alles über alle. Weil eines weiß er bereits: in jedem
schlummert ein Staatsfeind und Krimineller. Und der kann jederzeit erwachen.
Erste Anzeichen des staatsfeindlichen Potentials hat der Staatssicherheitsminister
bereits ausgemacht: schon heute weigert sich eine starke Mehrheit von gut 75% hartnäckig CDU zu wählen.
Und jetzt muss man sich nur einmal vorstellen, die Menschen nehmen irgendwann Lohnkürzungen,
miese Arbeitsbedingungen, Abbau von Versorgungsleistungen, die Zustände in den Pf legeheimen,
die Zerstörung ihrer Gesundheit und Lebensumfelds, die Unterordnung ihrer gesamten Lebensbedürfnisse
unter das Gebot der Prof itmaximierung, steigende Rüstungsausgaben und Kriegseinsätze, nicht mehr
einfach murrend hin, sondern beginnen, sich ihrer Haut zu wehren: streiken, besetzen Betriebe und
Häuser, statt über ihre Kaputtsanierung bloß zu lamentieren, und pfeifen gar auf den Staat, den
sie nur als Sachwalter der Reichen kennen gelernt haben. Da ist es dann natürlich zu spät,
wenn man nicht schon vorher über jeden Bescheid weiß, wann er sich wo aufhält und wozu alles er fähig ist.
Für alle, die sich auch in Zukunft alles gefallen lassen wollen, was Staat und Kapital ihnen
einbrocken, für die geborenen Untertanen also, ist die totale Überwachung und Erfassung ihrer
Person natürlich kein Problem.
Prestigeobjekt
Stuttgart 21: Drei Milliarden
für drei Minuten
Bahnhof unter der Erde -
Demokratie auch
(von
Ralph Schelle) Stuttgart 21. Eine brillante Idee: Schnellere Bahnverbindungen,
eine Vergrößerung des Stadtparks und gleichzeitig die Entstehung einer schönen,
neuen Innenstadt auf dem Gelände der dann nicht mehr benötigten Gleise ?
Das Projekt, im April
1994 präsentiert und
1995 per Rahmenvereinbarung
gefestigt, kämpfte alsbald
mit der harten Front
der bitteren Realitäten.
Kristallisierte sich
doch bald heraus, dass
das Prestigeobjekt Tiefbahnhof
nicht nur stets teurer
wurde, sondern nicht
nur angesichts sinkender
Verkehrszuwächse auch
noch unwirtschaftlich.
Auch die anfangs bürgerfreundlichen
Stadtentwicklungspläne
wurden schnell geändert:
Immobilienfreunde überzeugten
den Gemeinderat zur Genehmigung
einer dichten Blockbebauung
mit bis zu 60m (!) hohen
Häusern. Einen Vorgeschmack
der geplanten „Architektur“
erhält man, wenn man
sich die bereits jetzt
erstellten Gebäude der
LBBW hinter dem Hauptbahnhof
zu Gemüte führt.  Schwierig
wurde die Situation für
die S21-Planer vollends,
als führende Verkehrsexperten
in Gutachten feststellten,
dass der geplante 8gleisige
Tiefbahnhof („S21“) gegenüber
einem modernisiertem
16gleisigen Kopfbahnhof
(„K21“) erhebliche bahnverkehrliche
Verschlechterungen aufweist.
Da beim Tiefbahnhof aus
technischen Gründen Fahrplanabstimmungen
nicht mehr im gewünschten
Umfang vorgenommen werden
können, wären zahlreiche
Anschlussverbindungen
nicht besser, sondern
schlechter als mit der
wesentlich kostengünstigeren
Variante Kopfbahnhof
21. Dies war wohl auch
den Initiatoren des Projektes
S21 frühzeitig bewusst.
Die Bahn beauftragte
daher den Verkehrsexperten
Professor Martin mit
der Erstellung eines
Gutachtens zu den Bahnhofsvarianten
S21 und K21. Martin,
dessen Vaihinger Institut
zu einem beträchtlichen
Teil von Aufträgen der
DB abhängig ist, führte
eine pikante Berechnung
durch. Aus mathematischer
Sicht ist diese wohl
fehlerfrei, doch verwendete
er Berechnungszeiten
aus einer heftig umstrittenen,
sehr speziellen DB-Richtlinie.
Diese Richtlinie enthält
für Kopfbahnhöfe negative
und für Tiefbahnhöfe
positive Annahmen; Gegner
nennen diese „lex Stuttgart
21“. Wenig überraschend
lautete denn auch Martins
Berechnungsergebnis:
Der Tiefbahnhof sei gegenüber
einem Kopfbahnhof das
leistungsfähigere System.
Nachdem trotz dieses
Gutachtens zunehmend
gesicherte Informationen
hinsichtlich ungenügender
Verkehrsleistung, städtebaulichen
Betonsärge-Planungen
und vor allem zu explodierenden
Kosten durchsickerten,
drohten die Fronten
der S21-Jünger zu bröckeln.
Bahn und Politik reagierten.
Die Bahn schwang den
dicken Knüppel und versuchte,
die gegen S21 vor Gericht
Klagenden mit einer
Rechnung in Höhe von
115.000 €(!) zu ruinieren
(diese wurde seitens
des Gerichtes auf moderate
6.500 € gestutzt).
Die Politik reagierte
mit reichlich plumper
Agitation. Lautstark
wurde propagiert, dass Schwierig
wurde die Situation für
die S21-Planer vollends,
als führende Verkehrsexperten
in Gutachten feststellten,
dass der geplante 8gleisige
Tiefbahnhof („S21“) gegenüber
einem modernisiertem
16gleisigen Kopfbahnhof
(„K21“) erhebliche bahnverkehrliche
Verschlechterungen aufweist.
Da beim Tiefbahnhof aus
technischen Gründen Fahrplanabstimmungen
nicht mehr im gewünschten
Umfang vorgenommen werden
können, wären zahlreiche
Anschlussverbindungen
nicht besser, sondern
schlechter als mit der
wesentlich kostengünstigeren
Variante Kopfbahnhof
21. Dies war wohl auch
den Initiatoren des Projektes
S21 frühzeitig bewusst.
Die Bahn beauftragte
daher den Verkehrsexperten
Professor Martin mit
der Erstellung eines
Gutachtens zu den Bahnhofsvarianten
S21 und K21. Martin,
dessen Vaihinger Institut
zu einem beträchtlichen
Teil von Aufträgen der
DB abhängig ist, führte
eine pikante Berechnung
durch. Aus mathematischer
Sicht ist diese wohl
fehlerfrei, doch verwendete
er Berechnungszeiten
aus einer heftig umstrittenen,
sehr speziellen DB-Richtlinie.
Diese Richtlinie enthält
für Kopfbahnhöfe negative
und für Tiefbahnhöfe
positive Annahmen; Gegner
nennen diese „lex Stuttgart
21“. Wenig überraschend
lautete denn auch Martins
Berechnungsergebnis:
Der Tiefbahnhof sei gegenüber
einem Kopfbahnhof das
leistungsfähigere System.
Nachdem trotz dieses
Gutachtens zunehmend
gesicherte Informationen
hinsichtlich ungenügender
Verkehrsleistung, städtebaulichen
Betonsärge-Planungen
und vor allem zu explodierenden
Kosten durchsickerten,
drohten die Fronten
der S21-Jünger zu bröckeln.
Bahn und Politik reagierten.
Die Bahn schwang den
dicken Knüppel und versuchte,
die gegen S21 vor Gericht
Klagenden mit einer
Rechnung in Höhe von
115.000 €(!) zu ruinieren
(diese wurde seitens
des Gerichtes auf moderate
6.500 € gestutzt).
Die Politik reagierte
mit reichlich plumper
Agitation. Lautstark
wurde propagiert, dass
• der Tiefbahnhof Fahrzeitverkürzungen
von mehreren Stunden
erwirke (laut technischen
Unterlagen der Bahn
betragen diese gerade
einmal 3 Minuten)
•
bei Nichtverwirklichung
des Projektes der wirtschaftliche
Tod der Stadt bevorstehe
- analog zum Filbinger-Zitat
„wird Whyl nicht gebaut,
gehen in Baden-Württemberg
die Lichter aus!“.
• Auch würden wir vom
europäischen Netz abgehängt
(in welches wir freilich
längst fest integriert
sind).
• Daneben wurde
das laut Umfrage ungeliebte
Tiefbahnhofprojekt sprachlich
mit der (allgemein befürworteten)
Schnellbahntrasse Wendlingen-Ulm
verquickt. Es wurde
versucht, beide Projekte
mit „Stuttgart 21“ zu
bezeichnen. Zuletzt
taufte Ministerpräsident
Oettinger das Vorhaben
gar „Baden-Württemberg
21“.
Doch die Mehrheit
der Bürger ließ sich
nicht einmal durch die
teuren S21-Animationen
und 4-Farbdruck-Broschüren
überzeugen: Sie stellte
sich gegen das Prestigeobjekt.
Die Bürgermeinung jedoch
scheint keine Rolle
mehr zu spielen. Derzeit
scheint das Projekt
- ungeachtet der vorliegenden
Fakten - politisch durchgewinkt.
Die Gegner des Projektes,
allen voran die Bürgerinitiative
„Leben in Stuttgart“,
streben nun einen Bürgerentscheid
an. Oberbürgermeister
Schuster aber verweigert
den Stuttgarter BürgerInnen
jegliches Mitsprache-recht:
Ein Bürgerbegehren zu
S21 komme nicht in Frage.
Wir fassen zusammen:
Unser Bahnhof wird für
3 Milliarden € Kosten
verkleinert. Als Gegenleistung
erhalten wir 3 Minuten
Fahrzeitverkürzung.
Die Innenstadt wird
in einer Weise verändert
werden, wie es seit
dem Krieg nicht mehr
geschehen ist. Für mehrere
Milliarden Euro soll
ein Prestigeobjekt und
Politikerdenkmal gebaut
werden. Milliarden,
die woanders fehlen
werden. Bereits heute,
so Finanzministers Stratthaus,
wird unser Nahverkehr
wegen S21 gekürzt.
Und wir Bürger sollen
nicht darüber abstimmen
dürfen, was da mit unserer
Stadt passiert ?? Wenn
sich das bewahrheiten
sollte, wird nicht nur
der Stuttgarter Hauptbahnhof
vergraben, sondern ein
gehöriger Teil unserer
Demokratie gleich mit.

Ralph Schelle wohnt in Stuttgart
und arbeitet in Vaihingen. Er
ist seit mehreren Jahren Mitglied
der Initiative „Leben in Stuttgart”
Appell an Gemeinderat und Stadtverwaltung
Über 1000 Unterschriften gegen Bebauung der Honigwiesen
Über tausend Bürgerinnen und Bürger haben in Vaihingen mit ihrer Unterschrift
gegen die beabsichtigte Vernichtung der letzten Naherholungsgebiete im Stadtbezirk protestiert.
Selbst die Initiatoren der Unterschriftensammlung, der einstige Initiativkreis Schwabenbräu-Areal,
der sich inzwischen in „Initiative schönes, attraktives Vaihingen - Bürger für ein lebenswertes
Vaihingen e.V.” (ISA) umbenannt hat, waren beeindruckt, wie einhellig in Vaihingen die Pläne des
Gemeinderats, die Honigwiesen auch noch entlang der Katzenbachstraße zu bebauen, auf Ablehnung stoßen.
Die Initiative hofft nun, dass der Rückhalt, den die guten Gründe gegen eine Aufsiedlung des
Naherholungsgebietes bei der Vaihinger Bevölkerung gefunden haben, auch Stadtverwaltung und
Gemeinderäte von ihren Bauabsichten abbringen kann.
Auf der Oktober-Sitzung des Bezirksbeirats sollen die Listen mit der Bitte um Weiterleitung
an Gemeinderat und Oberbürgermeister übergeben werden. Dabei soll auch noch einmal deutlich
gemacht werden, dass die Initiative die Notwendigkeit weiteren Wohnungsbaus in Stuttgart
nicht in Frage stellt. Fehlen würde es allerdings vor allem an bezahlbaren Mietwohnungen,
die von Land und Gemeinde kaum noch gefördert würden. Und auch für diese müsse es andere
Standorte geben als die letzten verbliebenen Kaltluftentstehungsgebiete und Frischluftschneißen
in Stadtbezirken, die man in den vergangenen Jahren mit stark überzogener Gewerbebebauung schon
überbelastet habe. Eine Umnutzung leerstehender Bürogebäude sei da eher das Gebot der Stunde.
Die Militarisierung der Gesellschaft schreitet zügig voran
Deutschland im Krieg
Wer unter dieser Überschrift eine historische Abhandlung erwartet,
ist nicht auf der Höhe der Zeit. Tatsächlich ist die Bundeswehr seit des von
SPD und Grünen befehligten völkerrechtswidrigen Angriffs auf Jugoslawien permanent
an Kriegen zur „Wahrung deutscher Interessen” (Steinmeier) beteiligt. Was deutsche
Interessen sind, steht in den verteidigungspolitischen Richtlinien: „freier Zugang
(für deutsche Konzerne) zu Rohstoffen und Märkten in aller Welt”.
Nach Angaben der Bundeswehr sind derzeit rund 6.800 Soldaten im „Auslandseinsatz”.
Davon rund 3.000 in Afghanistan und Usbekistan und 2.192 im Kosovo. Dass die Regierung
Kriege inzwischen „Friedensmissionen” nennt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
sich weiterhin um Kriege handelt. Wenn Länder militärisch angegriffen und besetzt werden
wie in Jugoslawien und Afghanistan so ist das eben nicht „Aufbauhilfe”, sondern immer noch
Krieg und Besatzung. Wenn deutsche Soldaten die Ziele auskundschaften, die Amerikaner und
Briten dann bombardieren und dabei hin und wieder auch mal Hochzeitgesellschaften auslöschen,
so sind die einen nicht besser als die anderen.
Und wer den Agressoren und Besatzern des Iraks seine Flughäfen und Logistik-Einrichtungen für
den Transport von Tötungsmitteln und Soldaten zur Verfügung stellt, kann nicht ernsthaft
behaupten, er habe mit diesem Krieg nichts zu tun.
Mit der Rückkehr zur kriegerischen deutschen Großmachtpolitik, schreitet auch die
Militarisierung der Gesellschaft im Inneren zügig voran. In Erwartung eines inneren
Widerstands gegen Rüstungsgewinne und Sozialabbau werden eher im Stillen die Strukturen
für die Niederhaltung des „inneren Feindes” aufgebaut.
So wurden Anfang diesen Jahres vom „Verteidigungs”ministerium „Landeskommandos”
für „zivil-militärische Zusammenarbeit” eingerichtet, an deren Kommandospitzen sog. „Beauftragte
für die zivil-militärische Zusammenarbeit” stehen und denen die Koordination zwischen zivilen
Organisationen und den Streitkräften obliegt. Zudem wurden ca. 450 Verbindungskommandos zu
Landkreisen und Städten installiert. Die Kommandos sind ständige Mitglieder der lokalen
Krisenstäbe. Ergänzt wird diese personelle Militarisierung durch die institutionelle Verzahnung
wehrtechnischer und ziviler Sicherheitsforschung. Nach den Richtlinien des 123 Mio Euro
teueren „Programms zur zivilen Sicherheitsforschung” wird die Bundeswehr künftig auch in den
Lenkungsgremien der zivilen Sicherheitsforschung vertreten sein. Und auch die Nutzer der
Sicherheitstechniken, Polizei, Militär, Geheimdienste und private Unternehmen sollen besser vernetzt werden.
Mit diesem Programm wird die bisher noch geltende Trennung zwischen militärischer und
ziviler Forschung aufgehoben. Dass für die Verbindungskommandos Reservisten aus den
jeweiligen Gebieten eingesetzt werden sollen, zeigt die Stoßrichtung: Beabsichtigt
ist die regionale Rekrutierung, so dass den militärischen Leitungsstäben detaillierte,
örtlich gewonnene Erkenntnisse aus den Operationszonen künftiger Notstandsgebiete
angeboten werden können.
Auf dem diesjährigen Seminar für Sicherheitspolitik der Bundesakademie für Sicherheitspolitik,
die im direkten Auftrag der Bundesregierung arbeitet, wurde dann auch empfohlen, eine
Verfassungsänderung, bzw. Neuinterpretation des Grundgesetzes in Erwägung zu ziehen.
„Wir werden die Verfassung in wesentlichen Teilen, soweit sie die Streitkräfte und
sicherheitspolitische Vorsorge betreffen, überarbeiten müssen.” Und weiter: „die
Grundfragen der nationalen Existenz, die Frage über Krieg und Frieden, die Bestimmung was (..)
im deutschen Interesse liegt und welche Opfer dafür geboten sind” sollte nicht vom Parlament,
sondern vom Bundeskanzler entschieden werden. In jedem Fall müsse die Verfassung den Einsatz
der Bundeswehr im Innern ermöglichen.
(Quelle: www.german-foreign-policy.com)
Wen und was
vertritt der Verbund Vaihinger
Fachgeschäfte ?
Dem VVF sein Pavillon
Jetzt steht er also an neuem Platz, der Pavillon auf dem oberen Vaihinger Markt.
Und den allermeisten Vaihingern ist das völlig egal. Tatsächlich wirkt er, abgesehen von
der Ersetzung von Grünflächen durch kalte Betonquader, am neuen Platz angenehmer, vor
allem weil man ihn kaum mehr sieht. Wäre nicht so viel Aufhebens gemacht worden, viele
würden die Veränderung wahrscheinlich gar nicht bemerken.
Insofern kann man darüber
streiten, ob die Sache wirklich
50. 000 Euro - die Hälfte davon
aus Steuergeldern - wert war.
Dass der neue Standort und
die erhöhte Plattform für die
zwei Veranstaltungen des VVF
und das Heimatfest von Vorteil
ist, ist unbestritten. Warum
aber wegen des neuen Standorts
nun unzählige Einkaufswillige
den oberen Vaihinger Markt
frequentieren sollen, wo es
nach der Eröffnung der Schwaben-Galerie
und Schließung der Scharr-Passage
praktisch gar nichts mehr zum
Einkaufen gibt, bleibt wohl
das Geheimnis der VVF-Propagandisten,
denen dazu vorerst aber auch
nicht mehr einfällt, als dass
man nun vom Pavillon aus ohne
Verzehrzwang einen freien Blick
auf die Schwaben-Galerie habe.
Ausgerechnet den Gastronomen am
oberen Vaihinger Markt, deren
Gäste den Platz noch ganzjährig
beleben, wurden durch die Umsetzung
des Pavillons gravierende Einbußen
zugemutet. Während der ausgerechnet
im Sommermonat August stattfindenden
Bauarbeiten, waren ihnen über
gut 6 Wochen beträchtliche
Teile ihrer bereits teuer bezahlten
Freibewirtschaftungsflächen
entzogen. Der zeitweise ohrenbetäubende
Lärm der Bauarbeiten tat ein
übriges, um die verbliebenen
Tische von Gästen frei zu halten.
 Dass
der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte,
zu dessen Mitgliedern vor allem
so namhafte Vaihinger Fachbetriebe
wie die Commerz- und BW-Bank,
der AMW-Verlag mit Sitz in
Bonlanden, und das Dorint-Hotel,
aber gerade einmal drei Gaststätten
zählen, sich nicht für einen
Pachtnachlass bei der Stadt
einsetzte oder wenigstens eine
Entschuldigung vorbrachte,
sondern statt dessen den Wirten
ein fast im Mafia-Ton gehaltenes
Schreiben schickte, in dem
diese aufgefordert wurden,
am Wochende des Vaihinger Herbstes
pro Tisch im Freien 28 Euro
an den VVF zu bezahlen, andernfalls
die Außenbewirtschaftungsflächen
kostenpflichtig polizeilich
geräumt würden, weil sich der
VVF bei seinen Veranstaltungen
keine “Trittbrettfahrer” mehr
leisten könne, wirft schon
ein seltsames Licht auf den
Verbund. Falls man dort tatsächlich
der Meinung ist, dass der Vaihinger
Markt allein von zwei bis drei
Veranstaltungen lebt, so sollte
man das auch so sagen und nicht
so tun, als sei ein nur den
Festen nützlicher Standort
des Pavillons Garant für das
Florieren der Vaihinger Betriebe.
Eine dauerhafte Belebung des
oberen Vaihinger Marktes könnte
vielleicht durch regelmäßige
kulturelle Darbietungen ohne
bürokratische Regulierung
erreicht werden oder durch
das Aufstellen von Spielgeräten.
Aber dafür, so mussten kürzlich
Bezirksbeiräte, die einen entsprechenden
Antrag gestellt hatten, erfahren,
sei jetzt kein Geld mehr da. Dass
der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte,
zu dessen Mitgliedern vor allem
so namhafte Vaihinger Fachbetriebe
wie die Commerz- und BW-Bank,
der AMW-Verlag mit Sitz in
Bonlanden, und das Dorint-Hotel,
aber gerade einmal drei Gaststätten
zählen, sich nicht für einen
Pachtnachlass bei der Stadt
einsetzte oder wenigstens eine
Entschuldigung vorbrachte,
sondern statt dessen den Wirten
ein fast im Mafia-Ton gehaltenes
Schreiben schickte, in dem
diese aufgefordert wurden,
am Wochende des Vaihinger Herbstes
pro Tisch im Freien 28 Euro
an den VVF zu bezahlen, andernfalls
die Außenbewirtschaftungsflächen
kostenpflichtig polizeilich
geräumt würden, weil sich der
VVF bei seinen Veranstaltungen
keine “Trittbrettfahrer” mehr
leisten könne, wirft schon
ein seltsames Licht auf den
Verbund. Falls man dort tatsächlich
der Meinung ist, dass der Vaihinger
Markt allein von zwei bis drei
Veranstaltungen lebt, so sollte
man das auch so sagen und nicht
so tun, als sei ein nur den
Festen nützlicher Standort
des Pavillons Garant für das
Florieren der Vaihinger Betriebe.
Eine dauerhafte Belebung des
oberen Vaihinger Marktes könnte
vielleicht durch regelmäßige
kulturelle Darbietungen ohne
bürokratische Regulierung
erreicht werden oder durch
das Aufstellen von Spielgeräten.
Aber dafür, so mussten kürzlich
Bezirksbeiräte, die einen entsprechenden
Antrag gestellt hatten, erfahren,
sei jetzt kein Geld mehr da. |
|